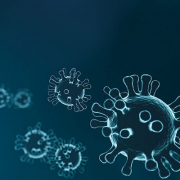Minimalinvasive Therapie an der Bauchaorta
Aussackungen der Bauchschlagader entstehen unbemerkt und enden oft tödlich. Ein neues Higtech-Verfahren, bei dem Gefäßstents eingesetzt werden, verhindert bei einem Aneurysma, dass die Schlagader reißt.
Aneurysma – die schleichende Gefahr
Ein Aneurysma entwickelt sich schleichend, verursacht keine Beschwerden und kann doch tödlich sein. Dabei handelt es sich um die Aussackung einer Hauptschlagader – hauptsächlich im Bauchraum oder im Gehirn, aber auch am Herzen. Die Gefäßwand dehnt sich allmählich auf wie ein Luftballon, wird dünner und droht zu platzen. – Dann besteht Lebensgefahr!
Generell kann ein Aneurysma an jeder Arterie auftreten. Am häufigsten entsteht es im Bauchbereich an der Hauptschlagader, es kann aber auch auf Höhe der Brust und an Hirngefäßen auftreten. Nach einem Herzinfarkt kommt es manchmal zu einer Aussackung an der Herzwand (Herzwand-Aneurysma). Liegt das Aneurysma im Bauchraum, an den Arm- oder Beinarterien, kommt es häufig zu einem Blutgerinnsel (Thrombus). Löst dieses sich ganz oder auch nur teilweise und wird mit dem Blutfluss weitertransportiert, kann es andere Gefäßabschnitte verstopfen. In diesem Fall sprechen Ärzte von einer Embolie.
Männer am häufigsten betroffen
Betroffen von einem Aneurysma sind vier bis acht Prozent aller Männer über 65 Jahre und 0,5 bis 1,5 Prozent der Frauen ab diesem Alter. Die Gefahr, dass die örtlich begrenzte sack- oder spindelförmige Auswölbung platzt, ist bei Frauen allerdings größer. Hauptursache ist Arteriosklerose. Risikofaktoren sind Rauchen, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit und eine familiäre Vorbelastung. Ältere Menschen sind aufgrund der altersbedingten Gefäßverkalkung eher gefährdet. Die Gefahr eines Risses wächst mit dem Durchmesser des Aneurysmas. Bei Männern wird es ab 5 bis 5,5 cm kritisch, bei Frauen ab 4,5 bis 5 cm.
Nicht selten ist die Diagnose „Aneurysma“ ein Zufallsbefund, z. B. wenn der Hausarzt ein Ultraschall das Bauches vornimmt oder der Orthopäde die Wirbelsäule röntgt. Aneurysmen der Bauchaorta verursachen meist keine Beschwerden. Wenn doch, treten oft folgenden Symptome auf: Nagender Schmerz im Unterbauch oder im unteren Rücken, manche Betroffene verspüren eine pulsierende Beule im Bauch oder die Verdauung spielt verrückt – mit abwechselndem Durchfall und Verstopfung.
Bessere Chancen für eine Früherkennung haben jetzt Männer über 65 Jahren. Seit 2018 zahlt die Krankenkasse für sie ein Ultraschallscreening als Vorsorgeuntersuchung. Die Untersuchung kann von Hausärzten, Internisten, Gefäß- oder Allgemeinchirurgen sowie von Radiologen oder Urologen vorgenommen werden und dauert nur wenige Minuten. Studien aus anderen Länder zeigen, dass diese Maßnahmen erfolgreich sind, die Zahl der Rupturen, der Notfalloperationen sowie der Todesfälle kann damit eindeutig gesenkt werden.
Allerdings wird eine weitere Risikogruppe bisher vernachlässigt: Frauen über 65 Jahren, die rauchen. Sie habe ein noch höheres Risiko als gleichaltrige Männer. Experten fordern daher, auch Frauen künftig in die Vorsorge einzuschließen.
EVAR – die minimalinvasive Therapie
Ist die Gefäßaussackung erst einmal entstanden, bildet sie sich nicht von allein zurück. Erhöhter Blutdruck treibt den Prozess voran und begünstigt die Gefäßaussackung. Jetzt heißt es, die Erkrankung im Blick behalten, das Fortschreiten der Gefäßaussackung bremsen und gegebenenfalls rechtzeitig operieren. Die meisten Aneurysmen müssen lediglich in bestimmten Intervallen per Ultraschall kontrolliert werden. Werden die Aneurysmen jedoch zu groß, ist unter Umständen eine OP notwendig.
Mit der endovaskulären Aortareparatur (EVAR) kann der Eingriff heute auch minimalinvasiv erfolgen. Hierbei führt der Gefäßspezialist einen Stent, der in einem Einführungskatheter zusammengefaltet ist, unter Röntgenkontrolle zur Aussackung. Der Stent schient das Aneurysma von innen und bildet ein neues Flussbett für den Blutstrom. Die Gefahr, dass das Gefäß platzt, ist damit gebannt.
Voraussetzung für einen erfolgreichen Eingriff ist ein erfahrenes chirurgisches Team und idealer Weise ein Operationssaal, der für Aortenchirurgie konzipiert ist. Vorreiter ist hier die Heidelberger Universitätsklinik, die bereits 2010 einen ersten gefäßchirurgischen Hybrid-OP eröffnete. Der Saal ermöglichst es, bei auftretenden Komplikationen schnell vom minimalinvasiven Eingriff auf die traditionelle offene Chirurgie zu wechseln.
Nicht zuletzt entscheidet auch eine gute Vorbereitung über den Erfolg der Behandlung. Heute kann die Bauchschlagader per Computertomografie und mittels Spezialsoftware millimetergenau vermessen werden, um den Stent optimal zu platzieren. Der Stent sollte im gesunden Abschnitt der Aorta oberhalb des Aneurysmas verankert werden. Außerdem bestimmt eine Planungssoftware Art und Größe der Endprothese.
War der Eingriff erfolgreich, ist die Gefahr der Ruptur gebannt. Jedoch muss der Patient lebenslang zu regelmäßigen Kontrollen per Ultraschall oder CT, um eine eventuelle undichte Stelle an der Landungszone des Stents auszuschließen. Trotz dieser Einschränkung entscheiden sich Chirurgen nach Möglichkeit für den minimalinvasiven Weg, da er schonender ist, des Infektionsrisiko kleiner bleibt und die Erholungszeit des Patienten kürzer ist.
Bei einer konventionellen OP wird in der Regel eine Kunststoff-Gefäßprothese (Interponat) eingesetzt, um das Aneurysma zu beheben. Dabei wird die Gefäßwand des betroffenen Abschnitts der Aorta aufgeschnitten und das Kunststoffstück mit den noch intakten Endstümpfen der Schlagader vernäht.
Aneurysma-Ursachen
Ein Aneurysma ist häufig Folge einer Arterienverkalkung (Arteriosklerose), die oft durch Bluthochdruck oder starkes Rauchen hervorgerufen wird. Die Gefäßwand wird starr und verliert ihre Elastizität. Mit der Zeit kommt es durch den hohen Blutdruck im Gefäß dann zu einem Aneurysma in Form einer sackartigen Erweiterung. Manchmal ist das Phänomen auch die Folge von Infektionen oder Entzündungen. Und in seltenen Fällen ist es angeboren, bspw. durch Bindegewebsstörungen oder eine Fehlbildung der Blutgefäße.
Wie lässt sich einem Aneurysma vorbeugen?
Eine gezielte Vorbeugung gibt es nicht. Es hilft allerdings auch hier, Risikofaktoren wie das Rauchen zu vermindern und einen generell gesunden Lebensstil zu pflegen. Dazu gehört eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse und körperliche Bewegung. Beispielsweise reichen bereits zwei- bis dreimal pro Woche je dreißig Minuten Radfahren oder Schwimmen, um das Risiko für Gefäßerkrankungen zu verringern.
Mehr Informationen? Beachten Sie auch unseren Ratgaber zum Thema Aneurysma.

 Pixabay / Darko Djurin
Pixabay / Darko Djurin 








 pixabay
pixabay